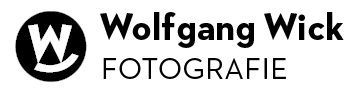Fundstücke
Im Grunde könnte uns gleich sein, wie diese Zeichen entstanden. Dann bliebe, abgelöst von jeglicher Herkunft aus der Welt der Dinge, der Ausdruck der Zeichnung, des filigranen Doppelstrichs im Format. Erstaunlich häufig mutet er an wie ein Mensch, tänzerisch, auf dem Sprung, sitzend oder weit vornüber gebeugt, verknappt auf das Wesentliche, den Kopf, eine Körpermitte und Extremitäten, ein drahtiges Wesen voller Spannkraft. Natürlich ist das eine Illusion, ein Hineinsehen von Bedeutung. Wer es sachlicher mag, sieht schlicht eine Ablichtung von Drähten, gefunden auf den Straßen einer großen Stadt …
VISUALS: FOUND AND FABRICATED
von Ludwig Ammann
ER MACHT BEIDES, und beides ist letztlich eins. Aber der Markt für visuelle Künste betont den Unterschied: Kunst ist, was aus freien Stücken entsteht und wenig nutzt. Das Andere der Kunst, das allzu nützliche Auftragswerk, gilt als Design. Zwar geht die Rechnung nicht auf – wo bleibt hier die Baukunst? Aber darum geht es nicht. Es geht ums Grafik-Design. Man kann davon leben, aber mit Kunst hat das, bitte, nichts zu tun. Am besten, man schweigt davon.
Es sei denn, ein Grafik-Designer steigt auf zum Künstler und kommt ins Museum. Wie Andy Warhol. Dann entdeckt der Kunstmarkt, nach einer Anstandsfrist, auch seine Werbegrafik. Und stellt fest: Sie ist ästhetisch und originell! Wäre es da nicht besser, man fragte von vornherein, was einer wie gestaltet? Versandhaus-Kataloge, die mit immer gleichen Bild-Formeln für immer gleiche Hemden und Schrauben werben, lassen uns begreiflicherweise kalt. Die Prospekte und Plakate von Wolfgang Wick nicht. Im Gegenteil. Darum sei hier, noch vor allem anderen, von dem die Rede, was – zumeist am Computer – in Wolfgang Wicks »Büro MAGENTA« entsteht. Im Auftrag. Aber mit vielen künstlerischen Freiheiten, die er nutzt. So gut, dass der Plakatier-Service beim letzten, geheimnisvoll glühenden Filmplakat um mehr Plakate bat: Das sei so gut, das würden die Leute abreißen, um es bei sich zu Hause aufzuhängen …
Gibt es ein schöneres Kompliment? Und muss man da verschweigen, dass Prospekte von Wick kleine typografische Wunder sind? Daran, wie er mit Buchstaben und Zahlen auf dem Papier umgeht, daran ist zu studieren, wie sehr die Typografie eine Kunst ist, oder vielmehr sein kann, eine Kunst von überraschender Schönheit. Schade, dass die meisten Zeitungen und Bücher davon nichts ahnen lassen!
Wolfgang Wick ist, das zeigt ein Blick auf den künstlerischen Werdegang, von Anfang an zweigleisig gefahren. Das Buch- und Offsetdrucken lernte er in einer Druckerei, die auch Holzschnitte von HAP Grieshaber verarbeitete. Nach dem Zivildienst in England folgte das Grafik-Design Studium in Pforzheim, wo die Verbindung von freier und angewandter visueller Kunst nach alter Ulmer Tradition selbstverständlich ist. Sein Jahr am Cal Arts Institute in Los Angeles nutzte er dazu, sich nicht nur computergrafisch auf den neuesten Stand zu bringen, sondern auch konzeptkünstlerisch tätig zu werden. Schon die erste »Tape«-Installation, der drei Jahre später noch eine zweite folgen sollte, verriet sein Interesse an Kunst im öffentlichen Raum – die Arena, bedenkt man‘s recht, des Werbegrafikers, der sich nicht auf Kommunikation im geschützte »white cube« der Galerien beschränken kann. Das schwarze Klebeband am Boden des Instituts wies den Weg – nämlich heraus aus der indexalischen Ordnung des kartesianischen Labyrinths, und zwar mit einem Gedicht: die Kunst als Ausstieg aus einem System von Pfeilen, die uns von A nach B verweisen, die Kunst als Selbstzweck. Auch die zweite Klebeband-Installation unterstrich das Selbstzweckhafte: Sehr schlicht und sehr ästhetisch verwehrten die transparenten Bänder als denkbar luftige Barrieren den Zugang zum Müllcontainer eines Parks. Eine offensichtlich temporäre Installation – denn selbstverständlich fordert die Notwendigkeit irgendwann ihr Recht. Aber zwischen zwei Entsorgungen gibt es einen Freiraum. Wer ihn nutzt, kann dort Schönheit finden, erfinden als ornamentale Verhüllung des Zwecks. Christo klingt hier an, aber Wick geht in der Vereinfachung einen Schritt weiter: von dessen antiästhetischen Verpackung und dann hyperästhetischen Verhüllung zur angedeuteten Klarsicht-Hülle.
1989 bot sich endlich die Gelegenheit, ein größeres Stück Kunst im öffentlichen Raum in der Heimat zu verwirklichen: das Projekt ZEBRA, mit dem Wick die Ausschreibung zum Beiprogramm der Ornamenta in Pforzheim gewann. Die Idee war so einfach wie schlagend: Man installiere eine Ampelanlage am Fluss – samt Verkehrsschildern, Fussgänger-Beleuchtung und Kanaldielen, die unter der Ampel wie ein Zebrastreifen über den Fluss führen. Der Effekt ist verblüffend, man steht und staunt und begreift, dass der Fluss schon lang zur Wasserstrasse wurde, gemacht wurde – nämlich begradigt und zum Teil sogar gepflastert: von wegen »heile Natur«! Das ist, so gesehen, ein brilliantes Stück Öko-Didaxe, so sinnfällig, dass es als »Heringsampel« in den Volksmund einging. Es ist aber auch, sehr versteckt, die Inszenierung einer inneren Spannung – denn das Problem der Bändigung von Natur zur Kultur geht den Künstler höchstselber an. Ganz besonders, wenn der »freie« Mal-Fluss vom strengen Regelwerk des Grafik-Designs gestoppt wird, der verinnerlichten Ampel. Davon später mehr.
Eine Auszeichnung für gute Buchgestaltung brachte Wolfgang Wick 1991 ein Stipendium an der Akademie Schloss Solitude ein. Er revanchierte sich mit zwei höchst unterschiedlichen Werkgruppen. Die eine leitete die Reihe der »Found Footage«-Präsentationen ein. »Found Footage« ist ein Begriff aus der Filmwelt, genauer gesagt dem Avantgarde-Kino. Er bezeichnet die Arbeit mit gefundenem, bereits belichtetem Material. Die Kunst verlagert sich hier ins »Editing« – den Schnitt, wenn es um Filme geht, oder allgemeiner die Auswahl, Anordnung und Präsentation, kurz das »Herausgeben« des Gefundenen. Das Verfahren entfernt sich denkbar weit vom traditionellen Modell des aus sich selbst heraus schöpferischen Künstlers, dem Typ des »Malers«; und es steht der Arbeitsweise des Grafik-Designers näher als man denkt – insofern letzterer am Bildschirm meist vorgefundene oder vorgegebene Bild- und Schriftelemente rekombiniert. Nur dass Wick mit den gefunden Drahtstücken, die er auf weißem Grund mit der Kamera porträtiert, nichts verkaufen will. Er zeigt ganz einfach eine Sammlung gestischer Formen, die stark an kraftvoll gesetzte Zeichen erinnern, eine Handschrift simulieren und doch, das ist die entscheidende Ironie, gerade nicht als »Strich des Künstlers« adoriert werden können.
Die »ZIFFER-N-Bilder« gehen den umgekehrten Weg. Hier werden schwungvoll handgeschriebene Ziffern nach allen Regeln der Kunst durch die Mühle modernster Reprotechniken gedreht, fotografiert, fotokopiert, eingescannt, hochgezogen und zu guter Letzt als zusammengesetzter Siebdruck präsentiert. Das Ergebnis ist ein schillerndes Hybrid aus Geste und Computertechnik – denn aus der Nähe löst sich der elegante Schwung in ein ästhetisches Pixelmuster auf. Im Grunde wird die altmodische Geste der Einmaligkeit wie bei Andy Warhol durch den Look der mechanischen Wiederholbarkeit glamourös modernisiert. Das grafische Design verkündet wie beim »Jetzt!«-Jugendmagazin der Süddeutschen eine Gegenwart, in der sich visuelle Jargons der Eigentlichkeit und digitaler Chic selbstironisch verbünden.
Schließlich: der Maler. Ein kleines Atelier hat er sich eingerichtet, das Gegenstück zum täglichen Arbeitsplatz im Grafik-Büro, sein Refugium. Hier malt er, mit Öl und mit Kreide, füllt Standard-Papierbögen von 70 x 100 cm Größe mit Gesten. Streicht ab und an den Pinsel auf einem anderen Papier ab, um die Farbe zu wechseln. Und entdeckt dann, eines Tages, mitten im Abfallprodukt – eine schöne Stelle. Schneidet sie aus, ein handgroßes Querformat, überarbeitet sie manchmal noch sparsam mit ein paar hineingesetzten zeichnerischen Gesten, wenigen Linien nur, eingeritzt oder mit Farbe aufgetragen. Fertig ist das Werk. Oder auch nicht. Denn es geht weiter: Einscannen, am Computer bearbeiten, drucken – als Postkarte oder als großer Siebdruck. So wird aus einem eher unscheinbaren Gelb-Feld durch Kontrastverstärkung ein feinnervig differenzierter Gelb-Rot-Fächer; und eine Kreuzung mehrerer kurzer Farbbahnen erweist sich als Material für denkbar gegensätzliche Ausdeutungen: in dramatischem Rot-Gelb auf einer Postkarte, in samtigem Schwarz mit sattem Ocker-Grund und Karmesin-Gespinsten darüber auf dem Siebdruck – und ausgedünnt, ohne Grund, mit Blau statt Rot auf einem anderen. Viel später fällt es uns wie Schuppen von den Augen: dass ein noch reduzierteres Siebdruck-Motiv in Blau nichts anderes ist als das aufgesetzte Gespinst, ganz ohne Kreuz und Grund! Mit anderen Worten: Wick setzt hier, im Kontext von Malerei, sein Found Footage-Spiel fort und steigert es virtuos. Denn wo er sich bei den gefundenen Drahtstücken – auch sie nur Abfall! – streng auf Kadrierung beschränkte, ein minimales Editing, macht er nun, bei den Farbabstrichen, weit über das bloße Ausschnitt-Setzen von allen Möglichkeiten des Fortdichtens eines schöpferischen Zufalls Gebrauch. Das Ergebnis ist ein starkes Plädoyer fürs Handwerk in der Kunst, für das, was die Kunstakademien des nun vergangenen Jahrhunderts allzu voreilig als Kunsthindernis deklarierten. Denn die Kraft dieser Werke verdankt sich nicht zuletzt der gekonnten Manipulation des Vorgefundenen und Absichtslosen.
Und die großformatige Malerei? Auch hier zielt Wick zunächst auf Absichtslosigkeit. Das führt in bestimmten Werken zu einem All-over breiter Pinselschwünge, das fortwuchert, bis das Blatt zugemalt ist. Das erinnert im Endeffekt nicht nur bei blauem Grundton an einen Ausschnitt tosender See, und dokumentiert einen Akt der Befreiung aus der Zwangsjacke des grafischen Regelwerks: Welch Hochgefühl, den Ausdrucks-Fluss technisch unvermittelt und vor allem ungebremst ausagieren zu können! Dennoch ist für den Betrachter am Ende weniger mehr. Sprich: Auf Dauer faszinieren gerade die Blätter, die den Fluss bändigen, bevor er über die Ufer tritt. Das sind die Werke, die sich auf wenige gestische Pinselschwünge beschränken, über die sich ein filigranes Netz von Strichen legt. Die malerischen Elemente umspielen mit Hell-Dunkel-Konstrasten die Monochromie, die dadurch Tiefe gewinnt, die zeichnerischen Elemente fügen angrenzende Farbtöne und ornamentalen Feinschliff hinzu. So entsteht ein spannungsreiches Gleichgewicht von Bewegungs-Strömen, in denen sich Kräfte aufbäumen, und einem Gespinst von Graphismen, die feinste Erregungen aufzeichnen. Der lyrischen Abstraktion, der zarten Stimmungsmalerei steht Wick fern. Seine Haltung nähert sich vielmehr den freiesten Werken der chinesischen Kalligraphie: Ein weit ausgreifendes, in sich differenziertes Zeichen sprengt die Ausdrucks-Fesseln im Überschwang des Augenblicks und tanzt übers Blatt.
Das ist der notwendige Gegenpol zur strengen Buchdruckerkunst, der Arbeit mit vorgegebenen Schriftsätzen und immer gleichen Satzspiegeln, die den Gestaltungs-Spielraum minimieren. Eines profitiert vom anderen: die freie Kunst vom Grafik-Design und umgekehrt. So, und nicht anders, findet Wolfang Wick auf beiden Spielfeldern zu gültigen visuellen Formen – found and fabricated.
Aussteigen bitte
von Beate Mitzscherlich
Auf der Strecke von Salzburg nach München bleibt der Zug plötzlich stehen. Nach längerer Zeit kommt eine Durchsage. Ein Stellwerk sei kaputt. Die Reisenden werden gebeten, mit ihrem Gepäck den Zug zu verlassen und an den Gleisen entlang in Fahrtrichtung bis zum nächsten Bahnhof zu gehen. Dort würden Taxis warten, mit denen sie ihre Reise fortsetzen könnten. Ungläubiges Raunen. Dann greifen die ersten nach ihren Sachen. Es ist nicht ganz einfach, die steilen Stufen hinunter zu klimmen, so ganz ohne Bahnsteig. Die Leute helfen sich gegenseitig mit ihrem Gepäck. Sobald wir draußen sind, fangen sie an zu telefonieren. Ein Geschäftsmann verlegt einen Termin. Eine Frau ruft mit klagender Stimme: »Schlecht geht es mir, Ingeborg. Der Zug ist stehengeblieben. Wir müssen zu Fuß gehen, bis zum nächsten Bahnhof!« Ein Mann in einer hellen Bundjacke ruft bei der Bild-Zeitung an: Ich hab da was für sie … 200 Reisende, darunter Schwerbehinderte, jawohl, mitten auf der Strecke ausgesetzt, jawohl, einfach unmenschlich, jawohl.«
Es sind vielleicht siebzig Menschen, die in einem kleinen Zug mit Koffern und Taschen über die Bahnschwellen klettern. Nach knapp 100 Metern gibt es neben den Gleisen einen Trampfelpfad, der führt nach weiteren 500 Metern zu einer kleinen Bahnstation. Die liegt inmitten von Rapsfeldern, die in der Morgensonne leuchten. Natürlich gibt es keine Taxis. Wie immer in Notsituation reden die Leute plötzlich miteinander, die meisten regen sich über die Bahn auf, ein junger Mann organisiert per Handy ein paar Taxis, damit wenigsten die Leute wegkommen, die zum Flughafen müssen. »Das sollten wir Eana doch zoalen, die Müh« ruft einer der so Begünstigten. Der Mann winkt ab. Unser Zug hat sich inzwischen in Bewegung gesetzt und fährt rückwärts davon. Auf den Handys ist inzwischen von 300 Menschen die Rede und von einem kilometerlangen Weg über Stock und Stein. Ich sitze auf dem Bahnsteig und esse mein Reisebrot. Es riecht nach Raps. In der Sonne ist es richtig warm. Es dauert zwei Stunden bis für die restlichen Reisenden ein Personenzug mit drei Hängern zur Verfügung gestellt wird …
Eine Frau hat sich als Rechtsanwältin zu erkennen gegeben und rät allen, sich unbedingt bei der Bahn zu beschweren und Schadenersatz zu verlangen: Sonst passiert von denen aus gar nichts! Nachdem wir eingestiegen sind, telefoniert sie mit ihrem Mann: »Du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist …« Ihre kleine bezopfte Tochter drängelt sich dazwischen: »Cool, Papa« ruft sie in’s Telefon: »Wir mußten alle aussteigen und dann ist unser Zug weggefahren und wir haben alle auf dem Bahnsteig gesessen und dann ist ganz lange kein Zug mehr gekommen und eine Frau hat mir ein Kaubonbon geschenkt und da sind lauter gelbe Blumen auf den Feldern, die riechen wie, wie, wie …« »sag Frühling!« Die Mutter hat ihr das Handy aus der Hand genommen. »Bis später«, sagt sie in den Hörer.